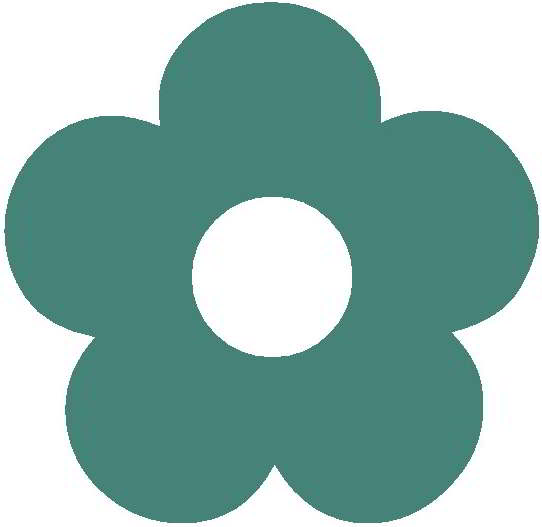Gartenfreud – Gartenleid
Viel "Gärtnerlatein" und noch mehr gefährliches Halbwissen tummelt sich im World Wide Web. Einer schreibt vom andern ab, ohne den Wahrheitsgehalt einer Information selbst genau zu prüfen (Problem: auch die Fachliteratur ist nicht ganz frei von Fehlern), und schon verbreiten sich Aussagen rasend schnell – ob richtig oder falsch.

Staudenbeet mit Phlomis russeliana (Brandkraut)
Meine Seiten basieren vielfach auf eigenen Beobachtungen (neben meinem Gärtnerwissen), ich beschönige nichts und sag, wie's is. Ich kann mir das leisten, denn ich will schließlich nichts verkaufen und auch keine Werbeeinnahmen damit generieren. Und Ihnen sind meine Erfahrungen vielleicht nützlich, wenn Sie Ihren Traumgarten anlegen, pflegen oder umgestalten wollen. Logisch, dass auch meine Erkenntnisse nur eine Momentaufnahme sind und sich auf den schweren Lehmboden (an manchen Stellen leicht sandiger Lehm) beziehen, mit dem ich mich wie auch mein Garten begnügen muss, sowie auf die Witterung/
Informationen zu den natürlichen Vorkommen der Pflanzen habe ich gänzlich unreflektiert aus der Fachliteratur übernommen, also Angaben zu Herkunftsländern und zu den vorherrschenden Verhältnissen (Boden, Licht, Wärme, Feuchtigkeit etc.) an den Naturstandorten.

Zwischen diesen beiden Fotos liegen gerade mal fünf Jahre

In den Schoß fällt ein eigenes Gartenreich nicht mal dem ambitioniertesten Hobbygärtner, der sich intensiv mit Boden, Standort, Klima und der Pflanzenauswahl befasst, bevor er loslegt. Ganz abgesehen von den "unerwünschten Beikräutern", die nicht unbedingt aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen müssen, sondern durchaus mit dem Pflanzenkauf importiert (also schlichtweg eingeschleppt) sein können. Nicht selten dämpfen zudem die Witterung sowie Schädlinge die Euphorie gewaltig.
Davon darf sich niemand entmutigen lassen, denn eines sollte im Vordergrund stehen: die Freude am Gärtnern. Gibt es etwas Spannenderes, als die Natur zu beobachten, und etwas Gesünderes, als sich bei Bewegung an der frischen Luft ein schönes Fleckchen Erde zu schaffen? Immer nach dem Grundsatz, dass nichts und niemand perfekt ist, und jedes Leben wachsen muss.
Denn was man im Garten lernen kann, sind Geduld und Ausdauer. Ein tolles Training, das so manches Seminar und etliche Coaches spart!
Das Internet – Spielwiese für jedermann

Aquilegia Clematiflora-Gruppe – Spornlose Akelei
Falsche Aussagen findet man im Internet zu allen nur denkbaren Themen zuhauf. Der Garten, die Gartengestaltung und Pflanzen wie Stauden, Gräser und Gehölze machen da keine Ausnahme. Das Problem: Als Laie kann man ob der scheinbaren Fachkompetenz, die die Seiten vermitteln, gar nicht anders, als ihnen Glauben zu schenken. Man weiß es schließlich nicht besser, deshalb sucht man ja! Ein Hinweis können da die Bilder auf einer Seite zu einer Pflanze sein: Sind die von irgendwoher zusammengetragen, dürfte es auch die Pflanzenbeschreibung sein.
Ein paar "Fachkenntnisse", die uns da vermittelt werden, stelle ich hier mal am Beispiel Akelei (Aquilegia) richtig.
Gib der Akelei die Sporen! – "Gärtnerlatein" aus dem Netz
- Die Akelei verschwindet nach der Blüte bis auf die unterirdischen Teile
Die Akeleien treiben nach der Blüte neues Laub (bei längerer Trockenheit erst etwas verzögert), das bis zum Winter erhalten bleibt (in milden Wintern sogar bis zum Neuaustrieb im Frühjahr). Bei Akeleien bleiben zudem immer oberirdische Teile (Spross) sichtbar, zu jeder Jahreszeit. - Das Abschneiden der Blütentriebe nach der Blüte soll eine Nachblüte im Herbst anregen
Das ist schlichtweg falsch, eine Akelei blüht nur einmal, und zwar im Frühjahr – ob mit oder ohne Rückschnitt. - Akeleien sollen dichte Wurzelgeflechte bilden, die sich nach allen Seiten ausbreiten, im Alter schwer auszugraben sind und die zur Vermehrung (vorsichtig, wird geraten, um die empfindlichen Wurzeln nicht zu verletzen!) geteilt werden können; das Teilen kräftiger und alter Pflanzen wird sogar mitunter empfohlen
 Wer so etwas (ab-)
Wer so etwas (ab-)schreibt, hat noch nie eine Akelei-Wurzel gesehen: Akeleien bilden fleischige Hauptwurzeln (Wurzeltyp: Rübe) mit nur wenigen Faserwurzeln, deren Teilung nicht nur unüblich ist, sondern in der Regel auch das Todesurteil für die Pflanze bedeutet. Es kann gelingen, wenn man sich gut damit auskennt und weiß, wo man das Messer ansetzen muss. Die Teilung ist jedoch so heikel und so wenig ergiebig, dass selbst Gärtner bei der Aussaat bleiben. - Beim Kauf soll auf gute Durchwurzelung der Topfballen geachtet werden
Dann bleiben die Gärtner auf ihrer Ware sitzen, denn einen gut durchwurzelten Topfballen findet man bei Akeleien mit ihren Pfahlwurzeln nicht. - Ausreichend Düngergaben während der Blüte sollen dazu beitragen, viele und große Blüten hervorzubringen
Während der Blüte? – Dann ist es zu spät. Wenn, dann brauchen die Akeleien den Dünger vorher. - Die Gewöhnliche Akelei benötigt nährstoffarmen Boden
Aquilegia vulgaris bevorzugt mäßig nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Standorte. - Akeleien dürfen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden, damit ihnen Frost nicht zu schaffen machen kann und um problemlos anzuwachsen
Quatsch, wie die meisten anderen Stauden auch, haben Akeleien mit Kälte und Frost kein Problem. Und außerdem: Wann blühen sie denn? Ab Mitte Mai! Und einer Pflanzung vor oder nach der Blüte ist stets der Vorzug zu geben gegenüber einer Pflanzung während der Blüte. - Die (sehr feinen) Samen sollen vom Wind verweht werden
Viel weht sich da nicht, Akelei-Samen sind relativ groß und fast schon schwergewichtig (ca. 600 Samen wiegen ein Gramm, zum Vergleich: bei der Karpaten-Glockenblume – Campanula carpatica – sind es ca. 14.000 pro Gramm), sie fallen und keimen meist nah bei der Mutterpflanze. - Als Aussaattipp gibt es die Empfehlung, die sehr feinen Akelei-Samen mit Sand zu mischen, im Aussaatgefäß zu verteilen und 3‑5 mm dick mit Erde abzudecken
Akelei-Samen ist nicht fein, schon gar nicht sehr fein, und daher braucht er auch nicht mit Sand gemischt zu werden. Sehr feine Samen im Aussaatgefäß ca. 3‑5 mm stark mit Erde zu bedecken, wäre zudem kontraproduktiv. 3‑5 m Abdeckung auf "winzig kleinen" Samen würde den Keimerfolg nachhaltig verhindern. Generell gilt: Sehr kleine Samen werden nur leicht angedrückt, bei größeren ist eine Abdeckung in Samenkornstärke okay.

- Akeleien haben Sporen
Nein, der Sporn, der am Blütenblatt vieler Akeleien ausgebildet ist, heißt im Plural Sporne. - Wenn die Pflanzen an ungünstigen Standorten stehen, sollte ihr Wurzelbereich vor dem Winter mit Laub oder Ähnlichem abgedeckt werden, um die Gefahr von Staunässe und gefrierender Nässe zu reduzieren
Eine Abdeckung mit Laub oder Ähnlichem ist bestenfalls ein Schutz vor Frost und vor starker winterlicher Sonneneinstrahlung. Vor Staunässe schützt sie nicht, weil sich der Begriff Staunässe auf die Sättigung des Bodens mit Feuchtigkeit bezieht, und Wasser verteilt sich im Boden nun mal relativ gleichmäßig. Eine Abdeckung verhindert im Gegenteil sogar das Austrocknen des Bodens. Unter einer feuchten – vielleicht auch noch dicken – Laubdecke faulen Pflanzen deshalb gern mal. Gegen Staunässe hilft nur ein sehr durchlässiger Boden mit gutem Wasserabfluss. Bleibt die Frage offen, was in diesem Zusammenhang ein "ungünstiger Standort" ist.

Das Buch mit sieben Siegeln: die botanische Nomenklatur
Die – man könnte fast sagen – gedankenlosen Veröffentlichungen im Netz bekümmern mich. Doch nicht nur die. Von Jahr zu Jahr bereiten mir die botanische Nomenklatur und die Zuordnung der einzelnen Pflanzen zu Gattungen und Arten mehr Bauchschmerzen. Zwar haben wir dank weltweiter Vernetzung heute Zugriff auf viele Datenbanken, deren Betreuer bemüht sind, den jeweils aktuellsten Wissensstand weiterzugeben. Andererseits: Vielversprechende Ansätze an Universitäten schlafen nach dem Wechsel des Professors ein oder verlaufen im Sand. Schade!
 Mit zunehmender Erforschung auch der molekularbiologischen Eigenschaften der Pflanzen wird das System allerdings immer uneinheitlicher statt eindeutiger. Der Grund: Die Wissenschaftler spalten sich in (wenigstens) zwei Lager. Während die einen weiterhin die schon immer praktizierte Einteilung der Pflanzen nach morphologischen (optischen) Gesichtspunkten favorisieren, wenden sich die anderen ganz den Erkenntnissen aus chemischen und genetischen Analysen zu. Und schon ist das Chaos perfekt, denn jeder sieht andere Zugehörigkeiten und arbeitet mit anderen botanischen Namen.
Mit zunehmender Erforschung auch der molekularbiologischen Eigenschaften der Pflanzen wird das System allerdings immer uneinheitlicher statt eindeutiger. Der Grund: Die Wissenschaftler spalten sich in (wenigstens) zwei Lager. Während die einen weiterhin die schon immer praktizierte Einteilung der Pflanzen nach morphologischen (optischen) Gesichtspunkten favorisieren, wenden sich die anderen ganz den Erkenntnissen aus chemischen und genetischen Analysen zu. Und schon ist das Chaos perfekt, denn jeder sieht andere Zugehörigkeiten und arbeitet mit anderen botanischen Namen.
Darüber hinaus werden weltweit (!) gültige Vereinbarungen zum Umgang mit den Pflanzennamen sowie "Spezialitäten" wie Begriffsbestimmungen ("Hybride, "Gruppe" zum Beispiel) und deren Verwendung regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und neu verhandelt. Das ist große Klasse, hier weltweit gültige Vereinheitlichungen zu verwenden, macht es aber nicht unbedingt leichter, stets auf dem Laufenden zu bleiben.
Die auf meinen Seiten genannten botanischen Namen sind in akribischer Kleinarbeit zusammengetragen und nach besten Wissen und Gewissen zugeordnet. Trotzdem: Alles ohne Gewähr. Sehen Sie es mir und der Gärtnerei Ihres Vertrauens nach, falls mal ein wissenschaftlicher Pflanzenname seiner Zeit hinterherhinkt (oder voraus ist).
Folgender Nachschlagewerke und ‑seiten habe ich mich dazu unter anderem bedient:
- Zander, Handwörterbuch der Pflanzennamen, 19. Auflage 2014, Verlag Eugen Ulmer – ISBN 978-3-8001-7953-4
- Der große Zander, Enzyklopädie der Pflanzennamen, 2008, Verlag Eugen Ulmer – ISBN 978-3-8001-5406-7
- Seybold, Die wissenschaftlichen Namen der Pflanzen und was sie bedeuten, 2002, Verlag Eugen Ulmer – ISBN 978-3-8001-3983-9
- Genaust, Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen, 3. Auflage 1996, Birkhäuser – ISBN 3-7634-2390-6
- Scripta geobotanica XVIII, Heinz Ellenberg et al., Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, 2. Auflage 1992, Verlag Erich Goltze, Göttingen
Zum Seitenanfang